
Studienkopf
Jener alte legendarisch-poetische Glanz, mit dem für die
Phantasie des Publikums, - und keineswegs nur des deutschen – während der
dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts die
Düsseldorfer Malerschule
umstrahlt wurde, war während der folgenden Jahrzehnte mehr und mehr verblaßt.
Schon zu Anfang der vierziger Jahre trat die Reaktion gegen den
überschwenglichen Enthusiasmus ein, welchen die Werke der jungen Meister
dieser rheinischen Schule eine Zeitlang erregt hatten. Immer schärfere Kritik
wurde an ihnen geübt. Die Vergleichung mit den Schöpfungen der gleichzeitigen
französischen und belgischen Malerei, wozu dem deutschen Publikum damals erst
Gelegenheit geboten wurde, fiel meist zu Ungunsten jener Düsseldorfer aus. Der
glänzende Aufschwung der Münchener Malerschule, in der die Kartonzeichner
durch die Koloristen und die Virtuosen der Technik abgelöst worden waren, wie
der Berliner, in der endlich der größeste und früheste Vertreter des Realismus
in der Malerei,
Adolf Menzel, sich zu der ihm gebührenden beherrschenden
Stellung durch- und emporgerungen hatte, half dann für längere Zeit die
Düsseldorfer mehr und mehr in den Schatten zu stellen. Von den Meistern, die
einst ihren größten Stolz und Ruhm gebildet hatten, waren die einen aus dem
Leben geschieden, andere, wie Lessing und Schrödter,
Bendemann, Hübner, waren
dem Rufe nach anderen deutschen Kunststätten gefolgt. Fast nur die eine alte
Säule,
Andreas Achenbach, zeugte, - und zeugt noch heute – von der
verschwundenen Pracht des Altdüsseldorf der dreißiger Jahre; neben ihm halfen
sein jüngerer Bruder, Oswald, dessen schönes Talent sich erst um die Mitte des
Jahrhunderts entfaltete, und der originelle Meister religiöser Kunst von
Gebhardt den Ruf der rheinischen Kunststadt und –Schule erhalten. Der Größeste,
der aus jener Schule hervorgegangen war,
Alfred Rethel, blieb, da sein
wichtigstes Lebenswerk ein Zyklus von monumentalen Wandgemälden in Aachen
war, der großen kunstfreundlichen Menge im inneren Deutschland als Maler so
gut wie unbekannt. Nur seine 1848, 1849 und 1850 viel verbreiteten, durch
Faksimile-Holzschnitt vervielfältigten, tiefsinnigen, kraft- und
charaktervollen Totentanzzeichnungen ließen auch hier in weiten Kreisen doch
eine Ahnung der hohen künstlerischen Bedeutung ihres Erfinders und Zeichners
aufgehen.
So war immer dafür gesorgt, daß die rheinische
Malerstadt, wenn sie auch viel von jenem poetisch- romantischen Nimbus
eingebüßt hatte, mit dem sie in der ersten Jugendzeit der Schule umwoben war,
- als der Sitz ausgezeichneter Meister respektiert werden mußte, welche gegen
die in den anderen deutschen Kunststädten wirkenden, - abgesehen von wenigen
alles überragenden Größen, - nicht zurückstanden. – Bekanntlich kehrte eine
der Berühmtheiten und Mitbegründer der romantischen Altdüsseldorfer Schule,
Bendemann, der 1838 deren Sitz verlassen hatte, als er das Direktorat der
Kunstakademie zu Dresden übernahm, nach einundzwanzigjähriger Abwesenheit
wieder zur Heimat seines Ruhmes, nach Düsseldorf, zurück, wohin er 1859 als
Direktor der dortigen Kunstschule berufen wurde. Er war nun zwar seinem ganzen
Naturell und künstlerischem Wesen nach nicht der Mann, der befruchtend und
neues frisches Leben erweckend, zu wirken vermocht hätte. Aber dennoch ist aus
seiner Schule der Künstler hervorgegangen, der heute diese Stelle einnimmt,
die Düsseldorfer Akademie leitet und der durch die Größe seines Genies und
sein mächtiges Schaffen ihr erneuten Ruhm erworben, durch die Kraft des
Beispiels und der Lehre eine Schar von neuen Talenten herausgebildet hat, die
durch ihre eigenen Schöpfungen die besten Beweise für diese hohe Begabung
ihres Lehrers geben.
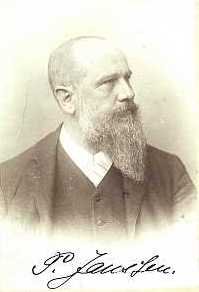
Dieser Meister und gegenwärtige Direktor der
Kunstakademie zu Düsseldorf ist Professor Peter Johann Theodor Janssen.
Weiter...
Hier klicken für die Biografie als komplettes Dokument.